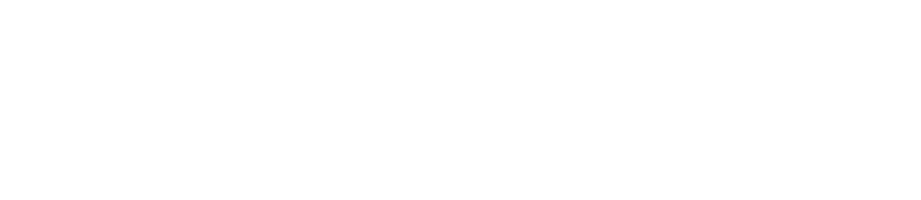14 Apr. Darf Kunst auch (wieder) inklusiv sein?
Oder: Warum Kunst alle Menschen erreichen – und nicht nur ein elitäres Spielfeld sein sollte
Inklusion überall – nur nicht in der Kunst?
Wir leben in einer Zeit, in der Inklusion als gesellschaftlicher Wert gilt. Ob im öffentlichen Raum, in Schulen, in Unternehmen oder in der Politik – der Zugang für alle wird gefordert und gefördert. Nur ein Bereich scheint sich dieser Entwicklung hartnäckig zu widersetzen: die Kunstwelt.
Dort ist Inklusion oft nicht erwünscht. Im Gegenteil – je weniger Menschen ein Kunstwerk verstehen, desto bedeutender scheint es zu sein. Wer nach Verständlichkeit fragt, gilt schnell als naiv. Wer Schönheit schätzt, wird als rückständig abgewertet. Und wer sich gar traut, eine gegenständliche Darstellung zu bevorzugen, wird aus dem etablierten Zirkel der Kunstschaffenden ausgeschlossen.
Unverständlich = genial?
Die moderne Kunst hat sich von der Allgemeinheit entfremdet. Statt Ausdruck von Menschlichkeit zu sein, wird sie häufig zum intellektuellen Rätselspiel. Kunst darf alles sein – aber bitte nicht schön, bitte nicht zugänglich, bitte nicht verständlich. Denn das könnte ja die „Tiefe“ gefährden. Aber ist das wirklich noch zeitgemäß? Ist ein Kunstwerk weniger wert, nur weil es Menschen berührt, statt sie zu provozieren? Oder sie vermeintlich zum Nachdenken zu bringen? Immer mit der Unterstellung, bei einem verständlichen, zugänglichen Kunstwerk, würden sie das nicht tun?
Kunst als Ausdruck – für alle
Wenn wir in der Geschichte zurückblicken, dann war Kunst nie nur für Kunstakademien, Galerien oder Kunstmagazine gedacht. Sie war Ausdruck des Lebens, der Kultur, des Gefühls. Menschen haben seit Jahrtausenden gemalt, geformt, gesungen – nicht um zu provozieren, sondern um zu verbinden. Um weiterzutragen, was sie erlebt oder gelernt hatten.
In einer Welt, die verlangt, dass alle dabei sein dürfen, jeder dazugehört, müsste doch gerade die Kunst ein Raum sein, in dem sich Menschen verstanden fühlen. Wo sie sich gesehen fühlen, wo sie mit dem, was sie mitbringen, ernst genommen werden. Wo sie eben nicht ausgeschlossen werden, weil sie keine akademische (Aus)-bildung haben.
Es geht nicht um „gefällige Bilder“ – es geht um Teilhabe
Niemand fordert, dass Kunst gefällig oder angepasst sein muss. Es geht nicht um eine Rückkehr zum Gegenstand als alleiniger Inhalt von Kunst. Oft können Dinge, die man selber nicht oder nur intuitiv versteht, nicht anders dargestellt werden als durch abstrakte Kunst. Aber warum dürfen Dinge, die man eben versteht und durchdacht hat, nicht so dargestellt werden, dass andere auch verstehen, was man meint. Warum sollten sie nicht genauso künstlerisch wertvoll sein? Warum darf es nicht verständlich sein – und gleichzeitig kraftvoll?
Kunst neu denken – jenseits der Selbstinszenierung
Wenn wir Inklusion ernst meinen, dann auch in der Kunst. Dann müssen wir uns fragen: Wen schließen wir gerade aus? Und wem sprechen wir das Recht ab, sich über Kunst zu äußern, Kunst zu machen oder Kunst zu verstehen? Vielleicht ist es an der Zeit, Kunst wieder als Begegnung zu begreifen – nicht als Bühne für Selbstdarstellung oder elitäres Denken. Vielleicht wäre es mutiger, Brücken zu bauen, statt Mauern zu errichten. Und vielleicht ist es heute provokativer, Schönheit zu zeigen als Zerstörung. Hoffnung statt Ironie. Klarheit statt Verwirrung.
Denn das braucht unsere Gesellschaft: Räume, in denen Menschen sich im wahrsten Sinne des Wortes wiederfinden. Auch, oder besonders, in der Kunst.