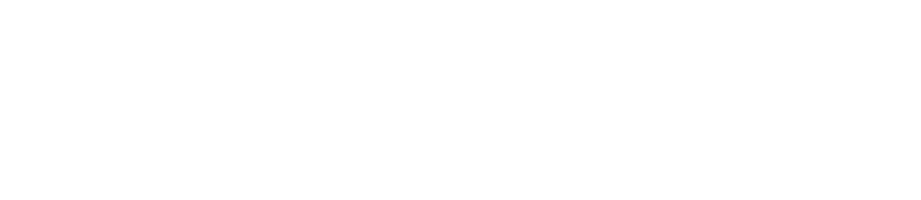02 Juli Warum Zeichnen und Malen ein Hauptfach in der Schule sein sollten
Kunst ist mehr als ein Hobby oder ein Nebenfach. Sie ist eine Sprache, eine Brücke zwischen innerer und äußerer Welt, ein Raum für Wachstum und Reflexion. Ich glaube fest daran, dass Zeichnen und Malen ein Hauptfach in der Schule sein sollten – für Kinder ebenso wie für Erwachsene, die in der Kunst eine neue Art des Lernens entdecken. Warum? Weil Kunst nicht nur Kreativität fördert, sondern unser Gehirn vernetzt, uns eine universelle Ausdrucksform schenkt und uns herausfordert, uns selbst zu begegnen.
1. Eine andere Art des Lernens: Kunst als Schlüssel zur Welt
Beim Zeichnen und Malen passiert etwas Magisches: Wir nehmen die Welt wahr, vergleichen sie mit unseren inneren Bildern und übersetzen diese in Bewegungen auf Papier oder Leinwand. Dieser Prozess ist eine einzigartige Art des Lernens, die weit über das Auswendiglernen von Fakten hinausgeht. Kinder, die zeichnen, lernen, ihre Umgebung genau zu beobachten, Muster zu erkennen und kreative Lösungen zu finden. Erwachsene entdecken in der Kunst einen Raum, um ihre Gedanken und Gefühle zu ordnen.
Wissenschaftliche Studien bestätigen: Kunstunterricht fördert divergentes Denken, also die Fähigkeit, neue Wege zu finden und Probleme kreativ zu lösen. Laut einer Untersuchung von Winner et al. (2013) verbessert Kunstunterricht die Fähigkeit von Kindern, Perspektiven zu wechseln und Emotionen zu verstehen. Diese Fertigkeiten sind in einer Welt, die Flexibilität und Innovation verlangt, unverzichtbar. Kunst lehrt uns, die Welt mit neuen Augen zu sehen – ein Lernprozess, der in jedem Alter transformative Kraft hat.
2. Kunst vernetzt das Gehirn: Ein Netzwerk für Kreativität
Zeichnen und Malen sind nicht nur kreative Akte – sie sind ein Workout für unser Gehirn. Wenn wir zeichnen, arbeiten visuelle, motorische und emotionale Regionen zusammen: Wir sehen ein Objekt, stellen es uns vor, planen die Bewegung unserer Hand und bringen Emotionen in Farben und Formen ein. Dieser Prozess vernetzt das Gehirn auf einzigartige Weise und fördert die Neuroplastizität, die Fähigkeit des Gehirns, neue Verbindungen zu bilden.
Forschung zeigt, dass Zeichnen die Konnektivität zwischen visuellen und motorischen Arealen stärkt (Chamberlain et al., 2014). Eine Studie von Schlegel et al. (2015) fand, dass regelmäßiges Zeichnen die graue Substanz im Gehirn erhöht, was räumliches Denken und Kreativität verbessert. Für Kinder ist dies besonders wichtig: Kunstunterricht stärkt kognitive Fähigkeiten wie Beobachtung und Analyse, wie Hetland et al. (2007) im „Project Zero“ der Harvard University zeigen. Kunst ist kein Luxus – sie ist ein Werkzeug, um das Gehirn zu trainieren und flexibel zu halten.
3. Bilder als vorsprachliche Sprache: Kunst verbindet uns alle
Bilder und Symbole sind älter als Worte. Sie sind eine universelle Sprache, die jeder versteht, unabhängig von Alter, Herkunft oder Bildung. Beim Zeichnen und Malen drücken wir Gedanken und Gefühle aus, die oft schwer in Worte zu fassen sind. Kunst eröffnet eine „andere Dimension“ der Kommunikation, die intuitiv, emotional und tiefgründig ist.
Die Kognitionswissenschaft unterstützt diese Idee: Der Neuropsychologe Merlin Donald (1991) beschreibt visuelle Symbole als Teil einer „mimetischen Kultur“, die vor der Sprache existierte. In der Kunsttherapie zeigt sich, dass Zeichnen Menschen hilft, Emotionen zu verarbeiten, die sie nicht verbalisieren können (Malchiodi, 2006). Für Kinder, die noch keine komplexe Sprache beherrschen, oder Erwachsene mit Sprachbarrieren, ist Kunst eine Brücke zur Selbstexpression. Sie ist eine Sprache, die verbindet – und die wir alle lernen sollten.
4. Kunst als Hauptfach: Eine Investition in die Zukunft
Warum also sollte Zeichnen und Malen ein Hauptfach sein? Weil es uns als Menschen ganzheitlich entwickelt. Kunst fördert Kreativität, emotionale Intelligenz und soziale Kompetenz – Fähigkeiten, die in der modernen Welt immer wichtiger werden. Studien zeigen, dass Schüler:innen mit Kunstunterricht bessere akademische Leistungen und höhere Abschlussquoten haben, selbst in benachteiligten Gruppen (Catterall et al., 2012). Die OECD (2019) empfiehlt, kreative Fächer wie Kunst stärker in den Lehrplan zu integrieren, da sie „21st-century skills“ wie kritisches Denken und Zusammenarbeit fördern.
Kunst ist auch inklusiv: Sie gibt Kindern mit Lernschwierigkeiten oder Sprachbarrieren eine Stimme. Sie reduziert Stress und stärkt die psychische Gesundheit, wie Studien zur Kunsttherapie zeigen (Shafir et al., 2020). In einer digitalisierten Welt, in der Bildschirme dominieren, bietet Kunst eine haptische, authentische Erfahrung, die Achtsamkeit und Konzentration fördert.
5. Resonanzraum Kunst: Ein Raum für Wachstum
Meine Vision des Resonanzraums Kunst, wie er in der Outdoor-Galerie am Wunderhof erlebbar ist, zeigt, wie Kunst Menschen verbindet. Kunst ist kein elitäres Gut – sie ist ein Raum, in dem wir Fragen stellen, uns selbst begegnen und wachsen. Zeichnen und Malen als Hauptfach würden diesen Raum schon in der Schule öffnen. Sie würden Kindern und Erwachsenen ermöglichen, Kunst als Sprache zu lernen, die sie ihr Leben lang begleitet.
Ich bin nicht allein mit dieser Idee. Auf Messen wie der NEUE ArT in Dresden sehe ich, wie Künstler:innen Kunst als zugängliches, persönliches Erlebnis gestalten. Eine neue Kunstrichtung entsteht – eine, die Inklusivität, Naturverbundenheit und Authentizität betont. Zeichnen und Malen als Hauptfach sind ein Schritt in diese Richtung: ein Schritt hin zu einer Welt, in der Kunst für alle da ist, um zu lernen, zu wachsen und sich auszudrücken.
Ich lade alle ein, mit mir zu diskutieren: Warum sollte Kunst nicht denselben Stellenwert haben wie Mathematik oder Sprachen? Zeichnen und Malen sind nicht nur ein Fach – sie sind eine Sprache, ein Werkzeug, ein Raum für Wachstum. Lassen Sie uns diese Vision gemeinsam Wirklichkeit werden lassen – für unsere Kinder, für uns alle.
Quellenangaben:
- Catterall, J. S., Dumais, S. A., & Hampden-Thompson, G. (2012). The Arts and Achievement in At-Risk Youth: Findings from Four Longitudinal Studies. National Endowment for the Arts.
- Chamberlain, R., McManus, I. C., Brunswick, N., Rankin, Q., & Riley, H. (2014). Drawing on the right side of the brain: A voxel-based morphometry analysis of observational drawing. NeuroImage, 96, 167–173.
Donald, M. (1991). Origins of the Modern Mind: Three Stages in the Evolution of Culture and Cognition. Harvard University Press. - Eisner, E. W. (2002). The Arts and the Creation of Mind. Yale University Press.
- Gardner, H. (1983). Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences. Basic Books.
- Guilford, J. P. (1967). The Nature of Human Intelligence. McGraw-Hill.
- Hetland, L., Winner, E., Veenema, S., & Sheridan, K. M. (2007). Studio Thinking: The Real Benefits of Visual Arts Education. Teachers College Press.
- Malchiodi, C. A. (2006). The Art Therapy Sourcebook. McGraw-Hill.
- OECD (2019). PISA 2021 Creative Thinking Framework. Organisation for Economic Co-operation and Development.
Schlegel, A., Alexander, P., Fogelson, S. V., & Li, X. (2015). The artist emerges: Visual art learning alters neural structure and function. NeuroImage, 105, 440–451. - Shafir, T., Orkibi, H., Baker, F. A., Gussak, D., & Kaimal, G. (2020). The state of the art in creative arts therapies. Frontiers in Psychology, 11, 252.
- Winner, E., Goldstein, T. R., & Vincent-Lancrin, S. (2013). Art for Art’s Sake? The Impact of Arts Education. OECD Publishing.